Wie nachhaltige Baustoffe klimaschonendes Bauen ermöglichen
Sanierung bedeutet heute weit mehr als nur Werterhalt. Sie stellt einen der wichtigsten Hebel für den Klimaschutz dar. Besonders relevant ist dabei die Auswahl ökologischer, langlebiger und kreislauffähiger Materialien. Diese entscheiden darüber, wie nachhaltig und zukunftssicher ein Gebäude tatsächlich wird.
Der CO₂-Fußabdruck des Bauwesens ist enorm. „Die Baubranche hat einen riesigen CO₂-Fußabdruck – rund 40 % der globalen Emissionen stammen aus diesem Bereich. Wenn die globale Zementindustrie ein Staat wäre, wäre sie nach China und den USA der drittgrößte CO₂-Emittent der Welt.

Deshalb müssen wir die Zementmenge reduzieren – etwa durch Ersatzstoffe oder alternative Bindemittel“, erläutert Dr. Volker Thome, seines Zeichens Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP.
Dabei geht nachhaltige Architektur weit über den Betrieb eines Gebäudes hinaus. Dr. Simon Schmidt, der ebenfalls in der Baustoffforschung des Fraunhofer-Instituts tätig ist, ergänzt dazu: „In Deutschland sind die Energiebedarfe im Betrieb inzwischen so niedrig, dass die ‚graue Energie‘ des Materials immer relevanter wird.“ Gemeint ist die gesamte Energie, die für Herstellung, Transport, Einbau, Nutzung und Rückbau eines Materials aufgebracht wird.
Nachhaltigkeit schließt zudem eine hohe Rückbaubarkeit und Schadstofffreiheit mit ein, wie Thome unterstreicht: „Nachhaltigkeit heißt, den gesamten Lebenszyklus mitzudenken – von der Herstellung über die Nutzung bis zum Rückbau.“
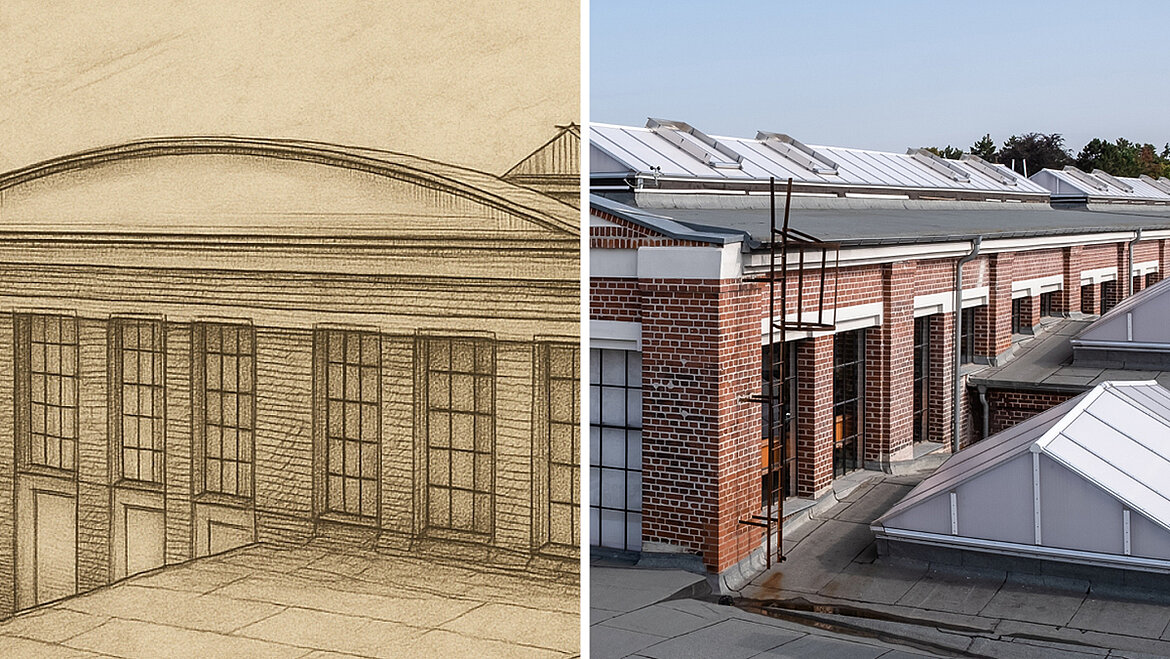
Lebenszyklus einer Immobilie
Wie nachhaltig ist ein Gebäude wirklich? Die Antwort liegt im Blick auf seinen gesamten Lebenszyklus – von der Planung bis zum Rückbau. Warum jede Phase zählt, zeigen wir in diesem Artikel.
Herausforderungen nachhaltiger Sanierung
Gerade in der Sanierung treffen Alt und Neu aufeinander. Die Herausforderung: Moderne, energieeffiziente Technologien müssen behutsam an die bestehende und zum Teil leider schadstoffbelastete Bausubstanz angepasst werden.
„Ich habe ein bestehendes Gebäude – mit einer bestehenden Bausubstanz, mit Baustoffen, die vielleicht nicht mehr verwendet werden dürfen oder sollten, etwa Asbest. Wenn ich da etwas ergänze, muss das langlebig, rückbaubar und idealerweise kreislauffähig sein“, erklärt Schmidt. Er nennt hierbei auch das Beispiel der Befestigung von Wärmedämmsystemen. „Während Wärmedämmverbundsysteme meist geklebt sind, sind Vorsatzschalen mechanisch befestigt und können rückstandsfrei demontieren werden.“ Entscheidungen wie diese müssen demnach akribisch bei der Sanierung mitgedacht werden und sind dabei große Hebel für mehr Nachhaltigkeit. Nachhaltiges Bauen im Bestand ist deshalb anspruchsvoll – birgt dafür aber auch ein enormes Potenzial für das ökologische Bauen und den Klimaschutz.
Stand der nachhaltigen Sanierung in Deutschland

Die Fortschritte sind messbar, aber derzeit noch immer stark begrenzt. „Die Sanierungsquote liegt aktuell bei unter 0,7 % pro Jahr – viel zu wenig“, gibt Dr. Simon Schmidt zu bedenken. Auch bei den Materialien besteht Verbesserungsbedarf: „Bei Fassadensanierungen kommen nur rund 9 % biobasierte Dämmstoffe zum Einsatz. Der Trend zeigt immerhin in die richtige Richtung – auch weil Förderung und Zertifizierung mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen.“
Programme wie KfW Energieeffizient Bauen setzen zunehmend auf nachhaltige Lösungen. Dennoch bleibt die Sanierung mit ökologischen Materialien bisher eher Ausnahme statt Regel.
Innovationen für nachhaltiges Bauen: Neue Materialien im Fokus
Die Wissenschaft entwickelt laufend neue, nachhaltige Baustoffe mit einem Ziel: CO₂-Emissionen drastisch senken, ohne Qualitätseinbußen. Vor allem das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP ist hier ein Vorreiter. Dr. Simon Schmidt und Dr. Volker Thome teilten hierbei folgende vielversprechende Strategien fürs nachhaltige Bauen und Sanieren:
- Geopolymere: zementfreie, betonähnliche Materialien mit nur ca. 10 % der CO₂-Emissionen herkömmlicher Betonvarianten
- LC3-Zement: eine Zementmischung mit 50 % minderem Zementanteil bei vollem Leistungserhalt
- Pyrokohlehaltiger Beton: Beton mit bis zu 30 % Pyrokohle, der rechnerisch klimaneutral ist
„Wir arbeiten an verschiedenen klimafreundlichen, zementarmen Baustoffen. Geopolymere sind ein Beispiel – das sind zementfreie, betonähnliche Materialien. Die CO₂-Emissionen liegen dabei bei nur etwa 10 % im Vergleich zu zementären Baustoffen“, erläutert Thome.
Ein weiteres Highlight: Pyrokohlehaltiger Beton, der rechnerisch klimaneutral werden kann. Dazu Dr. Thome: „Wir arbeiten daran, bis zu 30 % Pyrokohle in den Beton einzubringen – dann wird das Material rechnerisch klimaneutral.“

Historische Inspiration gibt es ebenfalls: „Der römische Beton beschäftigt uns – etwa im Pantheon in Rom. Unser Ziel ist es, aus historischen Baustoffen für die Zukunft zu lernen – denn nachhaltiges Bauen war schon damals möglich.“
Doch Innovationen betreffen nicht nur Materialien, sondern auch digitale Prozesse. „Unsere Lösung ist ein zentrales digitales Gebäudemodell, an das sich alle Projektbeteiligten andocken können. Damit lässt sich Sanierung effizienter und nachhaltiger planen“, ergänzt Schmidt.
Biobasierte Baustoffe – Fortschritt oder Risiko?
Materialien wie Holz, Seegras, Stroh oder Schafwolle gelten als ökologische Hoffnungsträger – bieten aber auch neue Herausforderungen. „Biobasierte Materialien bringen tatsächlich ein gewisses Spannungsfeld mit sich. Sie sind von Natur aus darauf ausgelegt, sich biologisch zu zersetzen. Das bedeutet: Unter bestimmten Temperatur- und Feuchtebedingungen, also genau den Bereichen, in denen wir uns auch wohlfühlen, können sie beginnen zu altern oder zu schimmeln“, erklärt Schmidt.
Entscheidend ist daher, die Rahmenbedingungen richtig zu wählen und Konstruktionen sorgfältig abzustimmen. Der Experte führt aus: „Biobasierte Baustoffe sind somit vielversprechend, aber ihre Dauerhaftigkeit hängt stark von Verarbeitung, Einbau und Umgebungsbedingungen ab – gerade im Sanierungsfall.“

Nachhaltige Materialien für moderne Dächer
Auch das Dach bietet Chancen für nachhaltige Baustoffe. „Wir arbeiten derzeit mit einem Partnerunternehmen an neuen Ziegelmaterialien, die Tonziegel widerstandsfähiger gegen Hagel machen sollen – ein wichtiges Thema angesichts zunehmender Extremwetter“, beschreibt Thome.
Biobasierte Materialien bieten auch für Dachsanierungen Potenzial, wie Schmidt betont: „Komplex wird es aber im Sanierungsfall, wenn etwa alte, dichte Dachschichten – wie Bitumenbahnen – erhalten bleiben und nur von innen gedämmt wird. Dann fehlt der Feuchtetransport nach außen, was zu Problemen führen kann, etwa an Wärmebrücken oder kritischen Bauteilübergängen.“
Die Wahl der Materialien sollte daher immer individuell auf das jeweilige Gebäude abgestimmt erfolgen – insbesondere bei energieeffizientem Bauen im Bestand.

Energetische Sanierung von Flachdächern
Ob steigende Energiekosten oder neue gesetzliche Vorgaben: Die energetische Sanierung von Flachdächern wird zur Schlüsselmaßnahme für nachhaltige Gebäude. Lesen Sie, wie sich Dämmung, Tageslicht und Dichtheit sinnvoll kombinieren lassen – für Effizienz, Komfort und Klimaschutz.
Praxistipps für nachhaltige Architekten und Planer
Wer nachhaltige Architektur anstrebt, braucht klare Ziele. „Definieren Sie zu Beginn des Projekts, was Nachhaltigkeit in Ihrem konkreten Fall bedeutet. Geht es um CO₂-Neutralität? Langlebigkeit? Rückbaubarkeit? Wenn dieses Ziel klar ist, können alle Entscheidungen daran ausgerichtet werden“, empfiehlt Schmidt.
Auch Digitalisierung und Planungstools spielen laut Schmidt eine entscheidende Rolle: „Wir bieten Planungsmodelle an, mit denen man schon in der Entwurfsphase die ökologischen Auswirkungen einzelner Bauteile abschätzen kann.“
Thome ergänzt: „Ich würde mir wünschen, dass mehr Projekte schon im Entwurf nachhaltige Materialien einplanen – dann lässt sich auch viel mehr erreichen.“
Zusammenfassend sind diese vier Tipps für den Projektstart also besonders hilfreich:
- Klare Nachhaltigkeitsziele festlegen (CO₂-Neutralität, Langlebigkeit)
- Umweltlabels und Produktdeklarationen beachten
- Expertenrat für Materialauswahl einholen
- Digitale Tools zur Ökobilanz nutzen
Natürliche Ressourcen als Baustein der Nachhaltigkeit

Neben Material- und Energiekonzepten sind es vor allem natürliche Ressourcen wie Licht, Luft und Wasser, die nachhaltiges Bauen prägen. „Alles, was ich passiv nutzen kann – etwa Sonnenlicht, Regenwasser oder natürliche Belüftung – sollte vorrangig genutzt werden“, so Schmidt. „Erst danach sollte Technik wie Photovoltaik oder Wärmepumpen ins Spiel kommen.“
Regionale Materialien bieten ebenfalls entscheidende Vorteile. „Die Römer haben schon vor über 2000 Jahren mit lokal verfügbaren Materialien gebaut. Das spart Transportwege – und damit CO₂. Auch heute sollten wir wieder stärker auf regionale Ressourcen setzen, statt alles über große Distanzen zu beziehen“, unterstreicht Thome.
Zukunftsblick: Visionen für das nachhaltige Bauen
Die Forschung ist klar: Die Zukunft des ökologischen Bauens liegt in zirkulären, CO₂-neutralen Materialien und neuen Wegen, Gebäude als Ganzes nachhaltig zu denken. Thome ist überzeugt: „In den kommenden Jahren wird es neue, zementfreie Betone und alternative Zementformulierungen geben müssen – denn bisherige Zusatzstoffe wie Flugasche oder Hüttensand stehen bald nicht mehr zur Verfügung. Wir entwickeln aktuell multifunktionale Baustoffe, aus denen sowohl tragende Bauteile als auch Dämmstoffe hergestellt werden können.“
Schmidt ergänzt abschließend: „Ich wünsche mir Gebäude aus möglichst wenigen, recycelbaren Materialien – sogenannte Monomaterialien –, die verschiedene Funktionen übernehmen und komplett wiederverwendet werden können. Nachhaltigkeit heißt für mich: CO₂-neutral, langlebig und gleichzeitig wohnlich.“
Der Ausblick der beiden Experten macht deutlich: Die nachhaltige Architektur steckt voller Potenzial – entscheidend ist, die Chancen moderner Materialien, kluger Planung und natürlicher Ressourcen zukunftsweisend zu nutzen. So kann jede Sanierung zum Leuchtturmprojekt für Klimaschutz, Lebensqualität und Wertsteigerung avancieren – ganz im Sinne des nachhaltigen Bauens.

Sanierung von Gebäuden
Sanierung ist der Schlüssel nachhaltiger Architektur. Doch zwischen Förderung, Klimazielen, Denkmalschutz und Klimaschutz verliert man schnell den Überblick. Wir haben die wichtigsten Themen rund um das energetische Sanieren für Sie gesammelt.

